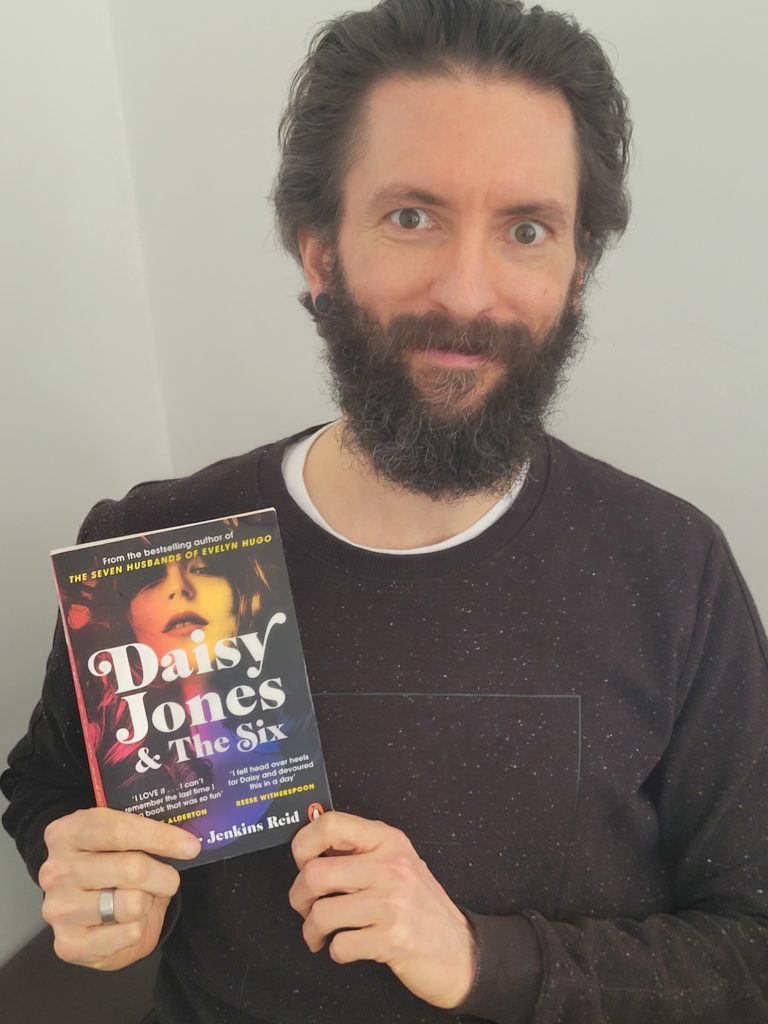von Alex

In der Welt der „vinylophilen“ Popkultur-Romane hat sich für mich ein Werk besonders hervorgetan, das bereits in unserem Podcast Erwähnung fand (höre hier) und nochmal einen „kleinen“ Bruder bekommen hat. Die Rede ist natürlich von High Fidelity von Nick Hornby aus 1995 und Telegraph Avenue von Michael Chabon aus 2012. Beide Romane erkunden auf ihre eigene Weise die Dynamik von Freundschaft und Musik im urbanen Leben. Doch inwieweit sind sie wirklich miteinander vergleichbar?
Telegraph Avenue
Michael Chabons Telegraph Avenue entführt uns in die pulsierende Atmosphäre von Oakland, Kalifornien, in der zwei Männer, Archy Stallings und Nat Jaffe, ihren eigenen Plattenladen, Brokeland Records, betreiben. Ihre Bindung wird nicht nur durch ihre Liebe zur Musik, sondern auch durch familiäre und geschäftliche Herausforderungen auf die Probe gestellt. Chabon webt geschickt eine Erzählung, die die Vielschichtigkeit des modernen Lebens in einer gentrifizierenden, diskriminierenden Stadt einfängt. Mit tiefsinnigem Humor und einer Flut von musikalischen Anspielungen (gleich mehr) zeigt er, wie Identität und Kultur miteinander verbunden sind.
High Fidelity
Nick Hornbys High Fidelity spielt im London der 90er Jahre und erzählt ebenfalls die Geschichte eines Plattenladenbesitzers (Championship Vinyl), Rob Fleming – im gleichnamigen und ebenso großartigen Film übrigens Rob Gordon, gespielt von John Cusack. Wichtig zu betonen: High Fidelity ist in Ich-Form geschrieben und treibt durch seine introspektiven Monologe die Handlung voran. Es dreht sich hauptsächlich um die Höhen und Tiefen von Flemings Liebesleben, während er Top-5-Listen von allem erstellt, was ihm in die Quere kommt. Gleich zu Beginn auf wunderbar neurotische Weise sogar die Top 5-Trennungen.
Hornby schreibt mit einem scharfen, ironischen Ton, der die männliche Psyche in der Midlife-Crisis bloßlegt. Sein London ist ein Mikrokosmos der Musik-Obsession und der Versuche, das Leben durch die Rillen von Vinylplatten zu verstehen. Der Stellenwert von Musik wird hier doppelt unterstrichen (Spoiler: Bald werden wir auch im Podcast über das Thema Musikkonsum und -wichtigkeit sprechen!). In einer Szene stellt sich Fleming vor, er würde gar Beziehungstipps vom Boss persönlich, von Bruce Springsteen, erhalten:
Show a little faith, there’s magic in the night
You ain’t a beauty, but hey, you’re alright
Thunder Road
Hornbys Werk brilliert durch seine unmittelbare und oft humorvolle Herangehensweise an die Lebensrealitäten der männlichen Generation X.
Unterschiede
Wo also liegen die Parallelen und Unterschiede zwischen beiden Werken? Beide Autoren erforschen die Männerfreundschaft in der Welt der Musik, jedoch mit ganz unterschiedlichem Fokus. Während Hornby sich auf die persönliche Reife und die Unfähigkeit, erwachsen zu werden, konzentriert, betont Chabon die sozialen und ethnischen Spannungen in einem sich wandelnden urbanen Umfeld.
Telegraph Avenue will dabei zu viel und weiß deshalb nicht immer, was es sein will. Klar, das Buch ist mit knapp 670 Seiten etwa doppelt so dick wie High Fidelity und bietet somit mehr Raum. In der Tiefe der Charakterentwicklung und der atmosphärischen Darstellung überragt Telegraph Avenue. Chabon kombiniert geschickt historische und soziale Themen mit eindrucksvoller Erzählweise, die sowohl einfühlsam, als auch unterhaltsam ist. Kritisieren könnte man indes, dass sich der Autor bei den vielen geöffneten Baustellen und Themengebieten verzettelt. So ist das Buch mal Gangsterklamotte in den zeitlichen Rückblenden zu Archie Stallings Vater, mal Gesellschaftsstudie in den Passagen mit Jaffes und Stallings Frauen, die gemeinsam als Hebammen arbeiten (ich war noch nie so nah bei einer Hausgeburt dabei, extrem stark geschrieben!) und mit Rassismus zu kämpfen haben (Archie Stallings Frau ist schwarz und im Übrigen selbst hochschwanger) und mal Coming of Age (Jaffes Sohn Julius ist dabei sich und seine sexuelle Orientierung zu finden). Dabei werden der Plattenladen und seine bedrohte Existenz, die immer wieder eingeworfene Musik und die absolut kultigen Tresengespräche im Laden (zu) weit in den Hintergrund gedrängt.
Apropos Musik
Bei der Musik gehe ich mit High Fidelity, aber nur knapp. In Chabons Werk lernen wir einen Plattenladen kennen, der sich auf anspruchsvollen Jazz spezialisiert hat, was zumindest meinen Horizont enorm erweitert hat. Wir lesen sowohl weltberühmte Namen wie Marvin Gaye, James Brown, Herbie Hancock oder John Coltrane, als auch eher unbekanntere wie Sun Ra oder Ornette Coleman (unbekannt zumindest für einen Rockmusik-Fan wie mich -Asche auf mein Haupt!).
Ich habe es geliebt, das Buch zu lesen, mir fleißig Notizen zu machen und mich anschließend durch die mir unbekannten Referenzen zu hören.
Bei Hornby hingegen werden Bands wie The Smith, Green Day, The Beatles oder The Clash thematisiert. Und was geht da schon drüber? Andererseits wird ein Kunde, der den Song „I just called to say I love you“ von Stevie Wonder sucht, von Flemings Mitarbeiter (im Film gespielt von Jack Black) hochkant aus dem Laden befördert.
Fazit
Insgesamt sind sowohl Telegraph Avenue als auch High Fidelity sehr lesenswerte Bücher der vinylophilen Popkultur, die durch ihre tiefgründigen Charaktere und ihre lebendige Darstellung der Musikwelt fesseln.
Beide Werke nutzen Musik nicht nur als Hintergrund, sondern als essentiellen Bestandteil ihrer Erzählung. Sie ist das Band, das die Charaktere und ihre Geschichten zusammenhält. Doch High Fidelity schafft es deutlich besser, sie als Destillat zu konzentrieren.
Telegraph Avenue: 7/10
High Fidelity: 8,5/10